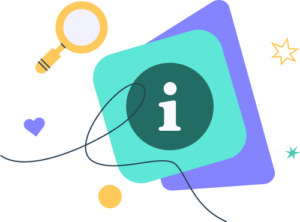Zugänglichkeit
Für einen Bildungserfolg ist es notwendig, dass Veranstaltungen und Inhalte „zugänglich“ sind. Medienbildungsangebote müssen also für alle Menschen gleichermaßen erreichbar und nutzbar sein. Dies umfasst den Umgang und die Kommunikation mit Teilnehmenden, technische Zugänge, sowie die Gestaltung und Verfügbarkeit von Medien und Begleitmaterialien.
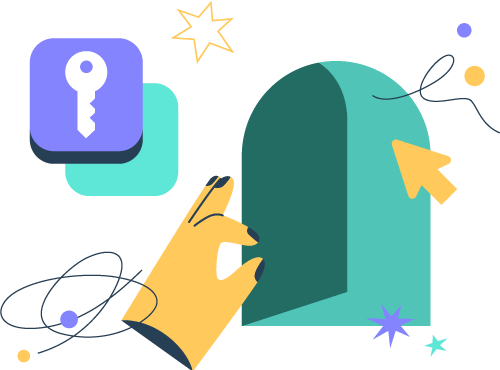
Die Dimension der Zugänglichkeit berücksichtigt die Diversität von Lernenden, deren Bedarfe und Möglichkeiten. Sie orientiert sich an Ressourcen und Voraussetzungen und hilft dir dabei, Barrieren abzubauen und Chancengleichheit zu fördern.
Fragebogen
Der Fragebogen kann helfen, gezielt zu reflektieren, wie Zugänglichkeit in der Medienbildung gefördert werden kann und welche Schritte noch nötig sind, um alle Menschen gleichermaßen zu erreichen.
Logbuch
Unter dem Punkt Logbuch findest du weiter unten nützliche Wissens-Snacks zum Thema Zugänglichkeit.

Reflexionsfragebogen
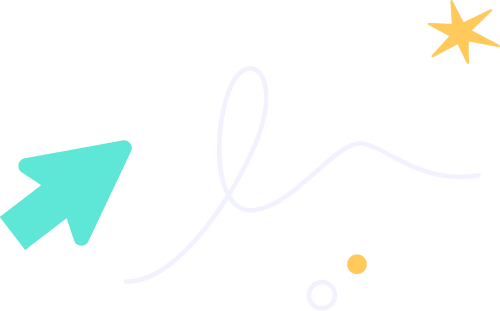
Barrierearmut
Barrierefreiheit ist essenziell, um allen Teilnehmenden einen gleichberechtigten Zugang zu Angeboten zu ermöglichen. Wir sprechen hier von Barrierearmut. Denn streng genommen geht es hier um einem Prozess, der nie abgeschlossen sein wird. Barrierearmut umfasst den Zugang und die Nutzbarkeit von Räumen, wie Rampen, Aufzüge, abgesenkte Türschwellen, Schalter für automatische Türöffnung und barrierearme Toiletten. Barrierearmut thematisiert aber auch zielgruppenorientierte Sprache – siehe Perspektive »Inhalte, Methoden, Sprache«.
Leichte Sprache
Hierzu ist es notwendig, dass du den Unterschied zwischen Leichter Sprache und Einfacher Sprache kennst, denn dabei gibt es feste Konventionen, die man einhalten sollte. Leichte Sprache hat Regeln, die festgeschrieben sind. Wenn du einen Text in leichter Sprache schreiben möchtest, dann gilt er erst als „leicht“ wenn er von Personen aus der Zielgruppe verifiziert und zertifiziert ist. Zu dieser Gruppe gehören v.a. Personen mit Lernschwierigkeiten oder geistiger Beeinträchtigung.

Weiterführende Links
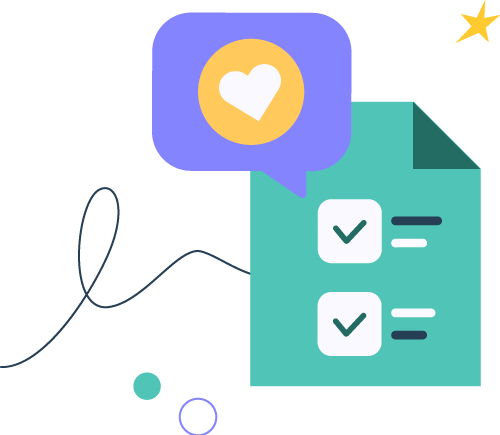
Einfache Sprache
Einfache Sprache kann von allen umgesetzt werden und richtet sich an alle Personen mit Verständnis- und Leseproblemen oder einer anderen Herkunftssprache. Einfache Sprache hat keine festen Regeln, aber Leitlinien, an denen du dich orientieren solltest. Heute gibt es auch KI-Tools, die dir bei der Umformulierung in Einfache Sprache helfen können. Wie bei allen KI-Anwendungen gilt aber auch hier, dass ein Kontrollblick nicht schadet.
Weiterführende Links
Arbeitsmaterialien
Verwende barrierearme Arbeitsmaterialien. Bildkarten sowie grüne und rote Karten zum Hochhalten können für Teilnehmende hilfreich sein, die Schwierigkeiten haben, sich mitzuteilen. Verwende bei deinen Materialien wenig Text und wenn, dann große und serifenlose Schrift, also Schrift ohne Schnörkel und Häkchen. Visualisierung durch Karten, Flipchartskizzen oder Präsentationstools helfen den Teilnehmenden, ihre Aufmerksamkeit zu fokussieren und „dabei“ zu bleiben.
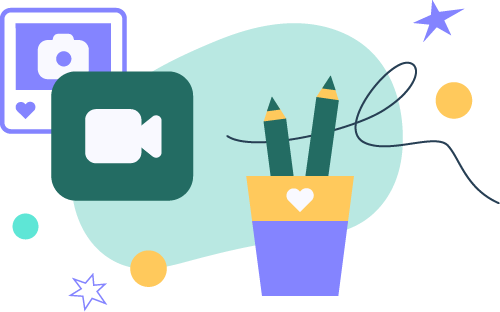

Medien
Darüber hinaus solltest du auch einen Blick auf die genutzten Medien werfen: Wie können Bedienungshilfen z.B. am Tablet eingestellt werden? Braucht es unterstützte Kommunikation? Vielleicht benötigst du Equipment wie besondere Stative, um etwa eine Kamera an einem Rollstuhl zu befestigen? Und wie barrierearm sind die Apps, mit denen du arbeitest? Am besten sollte der Umgang mit einer App sehr intuitiv und symbolgestützt erfolgen können, ohne viel lesen zu müssen.
Kommunikation
Um allen Personen eine angenehme und produktive Atmosphäre zu ermöglichen, sollte deine Sprache bildhaft sein. Schwierige Begriffe und Fremdwörter werden erklärt oder umschrieben. Du sprichst langsam und verständlich und vermeidest starken Dialekt. Bemühe dich um eine wertschätzende und bestärkende Kommunikation.

Weiterführender Link
Leihen
Dokumentation und Evaluation von medienpädagogischen Projekten
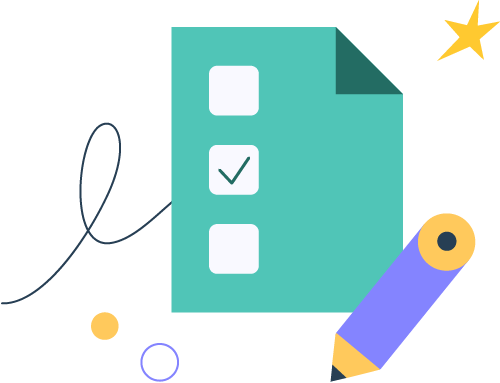
Die Dokumentation dient sowohl der Transparenz als auch der Reflexion der Arbeit und kann als wertvolle Grundlage für die Planung zukünftiger Projekte dienen. Eine fundierte Evaluation ermöglicht nicht nur eine objektive Bewertung des Projekts, sondern auch die Ableitung von Handlungsempfehlungen für zukünftige medienpädagogische Projekte.
Im Vorfeld eines Projekts kann es hilfreich sein, sich an folgenden Tipps zu orientieren:
- Teile dein Wissen aktiv mit anderen und schaffe Strukturen für einen effektiven Wissenstransfer im Team und in Netzwerken.
- Bereite Projektergebnisse so auf, dass sie für andere verständlich und leicht zugänglich sind – und finde passende Wege, sie zu verbreiten.
- Dokumentiere Inhalte so, dass sie für Dritte nachvollziehbar und bei Bedarf reproduzierbar sind.
- Unterscheide klar zwischen interner und externer Dokumentation – und passe Inhalt und Form entsprechend an.
- Entscheide bewusst, welche Informationen analog archiviert werden sollen und was digital erfasst wird.
- Nutze Flipcharts und Moderationswände gezielt zur Visualisierung und kombiniere sie sinnvoll mit digitalen Tools zur dauerhaften Sicherung von Inhalten.
Der Austausch zwischen den Projektbeteiligten sowie mit anderen Fachkräften im Bereich der Medienbildung fördert eine praxisorientierte Weiterentwicklung und sorgt dafür, dass die Erfahrungen und Erkenntnisse breit geteilt werden.
Freie Bildungsmaterialien
Du kannst auch darüber nachdenken, ob du deine Arbeitsmaterialien anderen zugänglich machst und als Open Educational Resources (OER) veröffentlichst. OER sind freie Bildungsmaterialien, die kostenlos genutzt, verändert und weiterverbreitet werden dürfen. Sie stehen unter offenen Lizenzen wie z. B. creative commons. OER senken Hürden, indem sie kostenlos und rechtlich unproblematisch nutzbar sind.

Sie erlauben Anpassung an unterschiedliche Zielgruppen, fördern Zusammenarbeit und Innovation im Bildungsbereich und tragen dazu bei, dass Lernchancen unabhängig von Herkunft oder finanziellen Möglichkeiten zugänglich sind. OER leisten einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung, indem sie Bildung demokratisieren und gemeinschaftliches Lernen fördern.
Weiterführende Links
Die Zielgruppe erreichen
Ein interessantes Angebot zu konzipieren ist das eine, das Angebot auch die geplante Zielgruppe zu bringen, erfordert aber oft nochmal einen gesonderten Aufwand. Die Zielgruppenansprache teilt sich in zwei Aspekte. Zum einen sollte die Zielgruppe so adressiert werden, dass sie Lust hat, zum Angebot zu kommen. Zum anderen sollte mit den Teilnehmenden in der Veranstaltung so kommuniziert werden, dass sie sich willkommen fühlen und das Angebot einen Bildungserfolg entfalten kann.
Öffentlichkeitsarbeit
Öffentlichkeitsarbeit hat die Aufgabe, Informationen zu vermitteln und die jeweilige Zielgruppe für das Angebot zu gewinnen. Um eine inklusive Kommunikation zu gewährleisten, ist es unerlässlich, Barrierearmut konsequent in die Konzeption und Umsetzung aller Maßnahmen zu integrieren und dabei sowohl digitale als auch analoge Wege sowie vielfältige Formate von Beginn an mitzudenken.

Denn Ziel ist, auch über die Öffentlichkeitsarbeit eine inklusive und benachteiligungsfreie Gesellschaft zu befördern. Eine inklusive interne Kommunikation ist die Basis für eine nach außen gerichtete Öffentlichkeitsarbeit.
Eine erfolgreiche barrierearme Öffentlichkeitsarbeit können folgende Aspekte mit Beispielen unterstützen:
Weiterführende Links
Adressierung
Zielgruppen sind divers. Daher sollten potentielle Teilnehmende auch auf diversen Wegen erreicht werden. So können Netzwerke, Gemeinden, Migrantenorganisationen, Ehrenamtsstrukturen und Communities gute Wege sein, Menschen anzusprechen, die mit herkömmlicher Öffentlichkeitsarbeit nicht erreicht werden können.
Genauso kann es hilfreich sein, Angebote dort zu platzieren, wo sich die Zielgruppe aufhält. So kann man die Strukturen nutzen, die Kirchen, Vereine oder auch Stammkneipen anbieten und die Leute direkt dort erreichen, wo sie sich bereits gerne aufhalten und wohlfühlen. Zusätzlich können Gebärden-, Kultur- oder Sprachmittler*innen Personen zu Angeboten Zugang verschaffen, die sonst ausgeschlossen sind, auch wenn das im Einzelfall einen Ressourcenaufwand bedeutet, der abgewogen werden müsste.
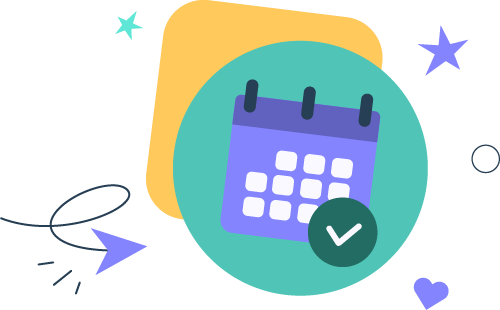
Genauso kann es notwendig sein, dass du weitere Besonderheiten deiner Zielgruppen berücksichtigst. Liegen auf deinem geplanten Termin Feiertage, auch nicht-christliche? Können Berufstätige auch an deinem Vormittagsworkshop teilnehmen? Sind Ferien und Eltern mit Familie möglicherweise verreist?
Zielgruppenansprache
Auch in einer Veranstaltung ist es wichtig, dass du dir der Diversität deiner Zielgruppen bewusst bist. Eltern sind nicht gleich Eltern, Senior*innen haben unterschiedliche Vorerfahrungen, Personen kommen aus unterschiedlichen Kulturkreisen und sozialen Schichten. Das alles beeinflusst, welche Analogien und Erklärungsmuster erforderlich sind, um Inhalte zu transportieren.
Du solltest ein Bewusstsein für die Bedarfe deiner Teilnehmenden entwickeln oder diese im besten Fall bereits bei der Anmeldung zu deiner Veranstaltung erfragen. Benötigt es Mittler*innen? Gibt es Barrieren, bei denen jemand Unterstützung benötigt? Gibt es Ernährungsrestriktionen?
Grundsätzlich ist es wichtig, auch kommunikativ Barrieren abzubauen. Manche Menschen schämen sich wegen fehlendem Wissen oder haben Angst bloßgestellt zu werden. Hier ist es wichtig, diese Leute ernst zu nehmen und konkrete Problemlösungen anzubieten.
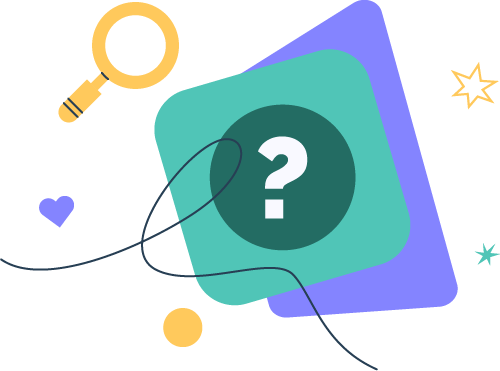
Kosten und Teilnahmebeitrag
Die Finanzierung von medienpädagogischen Projekten hängt eng mit der Förderungslage zusammen. Wenn eine Förderung vorliegt, kann der Teilnahmebeitrag geringer ausfallen oder sogar wegfallen. Wenn eine Teilnahmegebühr erhoben werden muss, um das Projekt zu finanzieren, dann sollte die Kalkulation zielgruppengerecht und auf die Bedürfnisse der Teilnehmer abgestimmt sein.

Um die Teilnahme für möglichst viele zugänglich zu machen, können Preisspannen angeboten, bei denen sich die Teilnehmenden selbst für einen Betrag zwischen 5 und 10 Euro entscheiden können. In der Kalkulation sollten nach Möglichkeit auch zusätzliche Kosten einberechnet sein z.B. für Gebärden-, Kultur- oder Sprachmittler*innen sowie Fahrdienste.
Weitergedacht
Didaktik
Auch wenn das Thema der Didaktik hier bereits an unterschiedlichen Stellen behandelt wurde, möchten wir im Rahmen der Perspektive „Zugänglichkeit“ ein paar allgemeindidaktische Hinweise formulieren, denn alle folgenden Punkte halten wir für wichtig, um sensiblen Zielgruppen ein erfolgreiches Bildungserlebnis zu bieten.
Bei diesen kann es z.B. erforderlich sein, Beziehungsarbeit zu leisten, bevor du inhaltlich ins eigentliche Thema einsteigst, um Berührungsängste abzubauen. Veranschlage regelmäßige Pausen, um Überforderung zu vermeiden. Veranstaltungen sollten bei Personen mit Verständnisproblemen eine Länge von fünf Stunden, inklusive Pausen, nicht überschreiten.
Versuche externe Störungen wir Lärm, andere Gruppen, starke Gerüche oder Klingeltöne auszusperren. All diese Faktoren können für Irritationen in der Gruppe sorgen oder sogar Desinteresse provozieren.
Hilfreich kann es außerdem sein, bei sehr heterogenen Zielgruppen, eine zweite Person zur Unterstützung im Projekt zu haben. So könnt ihr unmittelbar auf Teilnehmende reagieren und einen zufriedenstellenden Umgang mit Irritationen oder „Störungen“ finden.
Überlege dir eine Dramaturgie mit rotem Faden und baue Rückkopplungsschleifen ein, die auf vorher gesagtes Bezug nehmen. Achte außerdem auf eine methodische Vielfalt, um das Interesse deiner Teilnehmenden zu halten und schaffe, bei längeren Veranstaltungen, mit regelmäßigen Warm-Ups Abwechslung.
Weiterführende Informationen und Beratungsstellen