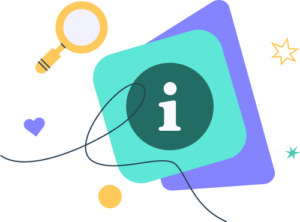Visionsorientierung
Die Klimakrise, das Artensterben, Armut und Hunger – es ist leicht, einen sehr negativen Eindruck vom Zustand unserer Welt zu erhalten. Beim Blick in die Zukunft drängen sich Gefühle der Ohnmacht und der Verzweiflung auf: Kann angesichts dieser vielen und riesigen Probleme die „Apokalypse“ aufgehalten werden? Lohnt es sich überhaupt, dass ich meine eigene Kraft und Energie für die „Rettung der Welt“ investiere? Wahrscheinlich hast du immer wieder ähnliche Gedanken und Fragen.
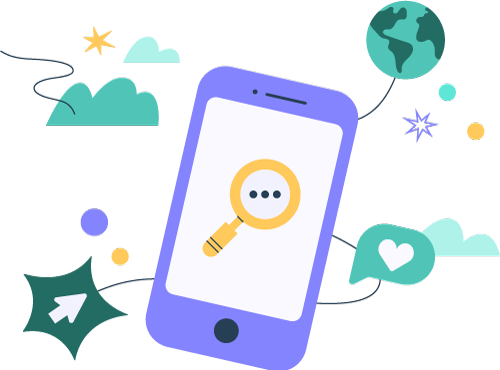
Vielleicht bist du resigniert, demotiviert, erschöpft. Wie lässt sich mit diesen Gefühlen und Zuständen umgehen? Welche Auswege kann es geben? Die Visionsorientierung kann Antworten formulieren und helfen „ins Handeln“ zu kommen und darin zu bleiben. Diese Perspektive ist sehr wichtig in der BNE und grenzt sie von anderen Bildungskonzepten ab.
Fragebogen
Du wirst dich genauer mit der Idee der Visionsorientierung und ihren Hintergründen befassen und kannst dich von Methodenbeispielen inspirieren lassen. Im Fragebogen wirst du deine eigene Visionsorientierung reflektieren.
Logbuch
Unter dem Punkt Logbuch findest du weiter unten nützliche Wissens-Snacks zum Thema Visionsorientierung.

Reflexionsfragebogen
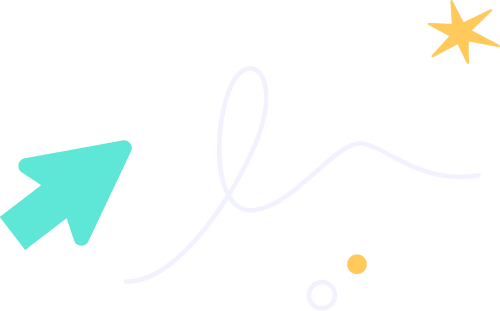
Grundlagen der Visionsorientierung
Warum sind positive Zukunftsvisionen wichtig?
Die Bedeutung positiver Zukunftsvisionen ist vielfältig. Sie können uns Mut machen, Hoffnung spenden und sind damit ein wichtiger Antreiber um ins Handeln zu kommen. Durch die Visionierung gewünschter Zukünfte entsteht in uns Lust, diese zu erreichen und uns für sie einzusetzen. Um gestalten zu können brauchen wir eine Vorstellung davon bzw. ein Gefühl dafür, wohin die Reise eigentlich gehen soll.

Das gilt für uns als einzelne Menschen genauso wie als Gemeinschaft. Denn nur, wenn ich von einer tollen und erstrebenswerten Zukunft erzähle, werden andere Personen diese Vision teilen können und mitmachen wollen. Angst vor der Zukunft lähmt uns, Lust auf eine Zukunft treibt uns an.
Visionsorientierung in der BNE
Im didaktischen Leitfaden „Zukunft gestalten lernen durch Bildung für nachhaltige Entwicklung“ werden die Grundlagen dieser zentral wichtigen BNE-Perspektive zusammengefasst:
„Die Frage, wie wir uns die Zukunft der Welt und der Gesellschaft wünschen, ist die Kernfrage nachhaltiger Entwicklung. Nachhaltigkeit ist somit ein optimistisches Konzept – es geht um die Entwicklung einer Vision für die gesellschaftliche Zukunft, in der gegenwärtig und zukünftig lebenden Menschen ein gutes Leben ermöglicht werden soll. Dieser optimistische Zugang muss auch die Bildungsangebote zu BNE prägen – dieser orientiert sich deshalb am Entwurf einer erwünschten Zukunft, an einer Vision.

Auf diese Weise wird Lernenden ein positiver, optimistischer Zugang zu gesellschaftlichen Entwicklungen ermöglicht; im Zentrum stehen also weder gesellschaftliche Probleme noch Katastrophenszenarios. Dies bedeutet jedoch nicht, dass gesellschaftliche Probleme nicht angesprochen werden sollen. In der Auseinandersetzung mit den Visionen werden gesellschaftliche Probleme, aber auch das Potenzial der Gegenwart besprochen.“ (ebd., S. 20)
Realitätscheck und Anerkennung
Damit Menschen ins Handeln kommen, sind zwei Dinge wesentlich:
Zum einen müssen sie verstehen, warum es dringend nötig ist, zu handeln – Stichworte: Erderhitzung, Klimafolgen, soziale Ungleichheit, Demokratieschwächung. Zum anderen brauchen sie eine Vorstellung davon, für welche konkrete Zukunft sie sich einsetzen können, also eine Vision.
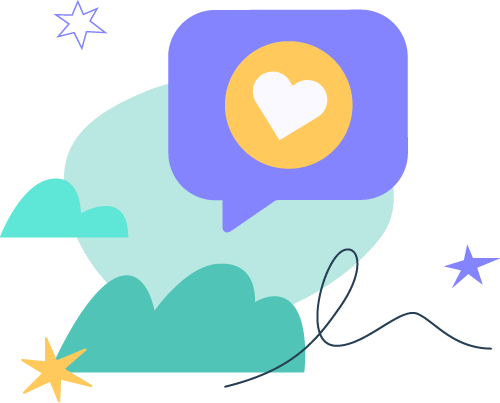
Beim Anerkennen und Handeln spielt ein weiterer Faktor eine entscheidende Rolle: Unsere Gefühle.
Die reichen von:
- Trauer (z. B. über den Verlust von Lebensräumen),
- Wut (z. B. auf Politik, Unternehmen, Ignoranz),
- Angst (z. B. vor persönlichen Schädigungen),
- Schuld,
- Ohnmacht,
- Hilflosigkeit und Resignation
Aber es gibt auch positivere Gefühle:
- Mut
- Tatendrang
- Gemeinschaftssinn
- Freude (zu handeln)
- Neugier
Die Gefühle thematisieren wir hier nur am Rande – es gibt dazu gute Angebote, z.B. lokale Klima-Cafés der Psychologists for Future, und das Buch „Klimagefühle“ von Lea Dohm und Mareike Schulze.
Aber so viel: Positive Visionen von Zukünften tun dem Gefühlshaushalt gut. Ins Handeln kommen ist das Gegenteil von Ohnmacht. Es scheint sogar so, dass Handeln die Voraussetzung für Hoffnung ist (vgl. Dohm 2025). Der herausfordernden Situation der Nachhaltigkeit lässt sich mit einem spannenden Gedanken begegnen:
Pessimismus des Verstandes,
Optimismus des Willens.
Antonio Gramsci
Weiterführende Links
Umsetzung von Visionsorientierung
Wie kommen wir vom Alten ins Neue?
Das Problem ist: die Entwicklung von Visionen wird häufig durch vertraute Denkmuster behindert. Wir Menschen konstruieren Tag für Tag Vorstellungen darüber, wie die Welt funktioniert und halten an ihnen fest. Ungewohntes, das mit den eigenen Vorstellungen nicht im Einklang steht, wird als „unsinnig“ oder „unmöglich“ abgestempelt. Neue Ideen und originelle Vorschläge werden dann als Träumerei abgetan. Das ist komisch, denn im Kindesalter sind Menschen durchaus fähig, die fantastischsten Visionen zu generieren. Kurz: Wir müssen durch Einsatz geeigneter Methoden einüben, kreative Ideen zur erwünschten Zukunft zu entwickeln und zuzulassen.
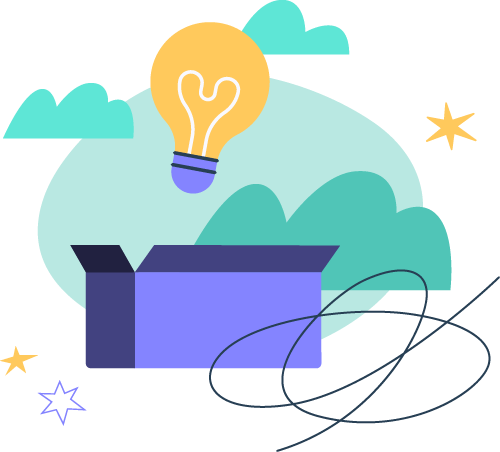
Methoden und Konzepte
Mediales Erzählen mit Visionsorientierung
Der Bezug zwischen Visionsorientierung und Medienbildung
Es ist sicherlich nicht möglich, die Bedeutung des Prinzips Visionsorientierung für die Medienbildung zu „bemessen“ oder ihren genauen Ort zu bestimmen. Dennoch kann sie auf mindestens drei Ebenen ins Verhältnis zur Medienbildung gesetzt werden:
1. Handlungsorientierte Medienpädagogik und Visionsorientierung als gegenseitige Unterstützer
Es liegt auf der Hand: Die Elemente vor allem aus der handlungsorientierten Medienpädagogik sind außerordentlich nützlich bei der Darstellung von Visionen. Durch die Gestaltung von z.B. Comics, Filmen, VR- und AR-Welten etc. lassen sich diese sicht- und greifbar machen. Das reine „Erzählen“ eigener Ideen wird so erweitert durch die mediale Vermittlung.
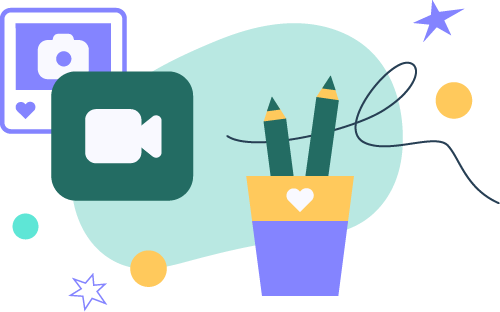
Die in der aktiven Medienarbeit etablierten Methoden können durch das Prinzip Visionsorientierung wiederum eine Sinnerweiterung erhalten: Die Teilnehmenden am Projekt erstellen dann Medienprodukte mit einem besonderen Gestaltungsanliegen und vermeiden so die Reproduktion gelernter und verinnerlichter klassischer Stereotype (wie z.B. die Kopie der zentralen Handlungslinien aus „Star Wars“ als Story für den eigenen Stop-Motion-Film). Die Geschichten können stattdessen individuelle Zukunftsvorstellungen zeigen und laden andere Menschen ein, an diesen Visionen teilzuhaben und zu ihrer Realisierung konkret beizutragen.
2. Visionsorientierung für uns als Medienpädagog*innen und unsere Projekte
Wir erarbeiten Konzepte für immer neue Projekte und Workshops und wollen so die Medienbildung stärken. Aber warum tun wir das? Oder besser gefragt: Wozu? Wahrscheinlich kommt es im Strudel von Förderanträgen, Sachberichten und Durchführungen von Veranstaltungen häufiger dazu, „den Wald vor lauter Bäumen nicht zu sehen.“

Was ist uns in unserer medienpädagogischen Praxis eigentlich wirklich wichtig, was (oder wen) wollen wir erreichen? Diese Fragen müssen sicherlich nicht immer klar beantwortet werden, doch kann die Visionsorientierung als hilfreiches Prinzip den nötigen individuellen Kompass anbieten. Ist dieser gefunden und lenkt unseren Blick auf die Dinge bzw. unser Vorgehen im Projekt, kann das Gefühl von Sinn und Resonanz entstehen.
3. Visionsorientierung für uns im Team
Diese Zusammenhänge lassen sich auf der Ebene der Arbeit im Team ebenso beschreiben. Das Gefühl, sich im Kreis zu drehen, liegt nahe angesichts der ungünstigen Kräfteverhältnisse zwischen z.B. den Big-Tech-Konzernen oder den politischen Hauptakteuren auf der einen und den freien Bildungsträgern auf der anderen Seite. Vor allem strukturelle und finanzielle Abhängigkeiten können die eigenen Entwicklungsperspektiven stark einschränken.

Dann kann es sehr helfen, sich auf einen gemeinsamen Kurs zu einigen. Wo wollen wir hin in und mit unserer Arbeit? Welche langfristigen Zielstellungen verfolgen wir bezogen auf unsere Themenfelder und Methoden? In welchen Organisationsformen möchten wir zukünftig zusammenarbeiten? Diese und ähnliche Fragen gemeinsam zu beantworten ermöglicht es, einzelne und kleinere Handlungsschritte in die „richtige Richtung“ ableiten zu können. Und die alltäglichen Hindernisse auf diesem gemeinsamen Weg immer wieder zu beseitigen.
Tipp
Die Methode „Palast der Visionen“ ist für Schulentwicklung konzipiert worden, lässt sich aber ohne Probleme auch für andere Teams nutzen.
Weiterführende Links
Zum Schluss noch eine (ganz subjektive) Liste toller Projekte, in denen aus unserer Sicht Visionsorientierung und Medienbildung zusammengefunden haben:
Wir freuen uns natürlich auch, wenn du diese Liste ergänzt und auf weitere Projekte hinweist.
Nimm dazu gern Kontakt mit uns auf.